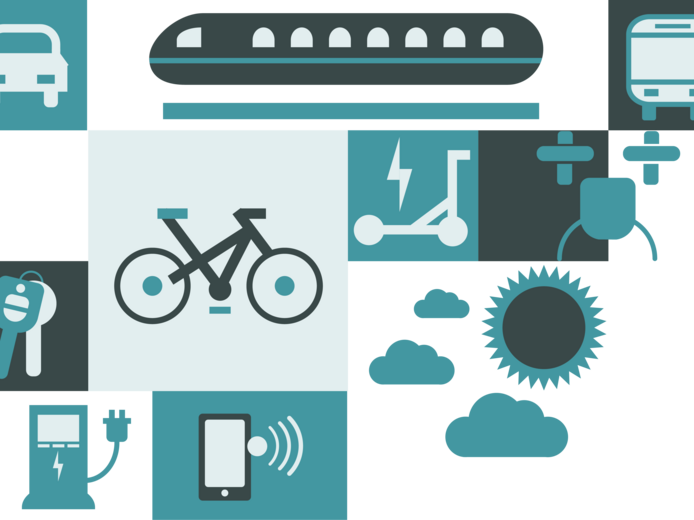Landwirtschaft in Tirol
Die Landwirtschaft in Tirol weist mehrere Besonderheiten auf, die für den Tourismus und die Freizeitwirtschaft bedeutsam sind. In diesem von Gebirge und alpinem Klima geprägten Raum spielt die Weide- und Raufutterverwertung durch Wiederkäuer eine zentrale Rolle in der Lebensmittelproduktion. Rinder, Schafe und Ziegen können für den Menschen nicht direkt verwertbares Grünlandfutter – etwa Gräser und Kräuter – in hochwertiges tierisches Ei-weiß (Milch, Fleisch) umwandeln.
Tirol ist kein Ackerland –96 % der landwirtschaftlichen Fläche sind Dauergrünland. Mit 78 % extensiv bewirtschaftetem Grünland hat Tirol den höchsten Anteil aller österreichischen Bundesländer. Dazu zählen z. B. nur einmal oder zweimal gemähte Wiesen, Almen, Bergmähder, Hutweiden und Streuwiesen. Diese Form der Nutzung ist ökologisch bedeutsam, führt zu hoher Biodiversität und schützt vor Erosion und Naturgefahren. Eine weitere Besonderheit ist die ausgeprägte Almwirtschaft sowie die Kleinstrukturiertheit.
Die Bedeutung der Landwirtschaft für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft
Die kleinstrukturierte alpine Landwirtschaft stellt eine nachhaltige und standortangepasste Form der Lebensmittelproduktion dar und erfüllt eine multifunktionale Rolle. Vor allem die charakteristische Kulturlandschaft ist Differenzierungsmerkmal und historische Erfolgsgrundlage für den alpinen Tourismus. Die Bewirtschaftung der Almen ergibt einen flächendeckenden Erholungsraum, der landschaftspsychologisch als besonders attraktiv gilt. Die Berglandwirtschaft erfüllt auch wichtige Infrastrukturfunktionen. In Tirol sind rund 7.000 Kilometer Forst- und Güterwege im Rahmen des Tiroler Mountainbikemodells für Freizeitsportler freigegeben. Beweidete Flächen bieten eine ideale Grundlage für Skipisten und reduzieren den Ressourcenbedarf technischer Beschneiung. Standortangepasste Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion entwickeln sich aus den jeweiligen naturräumlichen Gegebenheiten (z. B. Klima, Boden, Höhenlage). Sie führen nicht nur zu einem charakteristischen kulinarischen Angebot, sondern sind Ausdruck und Träger lokaler Kultur.
Synergien und Herausforderungen
Landwirtschaft, Tourismus- und Freizeitwirtschaft stehen in Tirol in einer engen Wechselbeziehung mit Synergien, aber auch Herausforderungen. Befragungen zeigen, dass Landwirte den Tourismus als zentralen Wohlstandsfaktor sehen. Viele Betriebe nutzen touristische Beteiligung – etwa als Vermieter oder Arbeitskräfte – zur Einkommensdiversifizierung. In Tirol gibt es laut Statistik Austria (2025) 2.544 Bauernhöfe mit Privatquartier oder Ferienwohnung. Für eine nachhaltige Sicherung touristisch relevanter Leistungen wie Kulturlandschaftspflege oder Wegeerhalt wäre aber deren Integration in die touristische Wertschöpfungskette notwendig. Kooperationen mit der Seilbahnwirtschaft und entsprechende Abgeltung, z. B. für Wegebau, leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Almwirtschaft. Demgegenüber
wird die Zusammenarbeit mit dem Gastgewerbe kritisch gesehen. Trotz des hohen Selbstversorgungsgrads bei Rind- und Kalbfleisch wird das Angebot österreichischer Produkte aus Sicht der Landwirtschaft
unzureichend genutzt. Es fehlen Daten zur Herkunft eingesetzter Lebensmittel, doch Schätzungen zeigen einen hohen Anteil an Importware. Demgegenüber erhöhen steigende Besucherzahlen und zunehmende Landschaftsnutzung den Aufwand für Besucherlenkung, Schadensbeseitigung und Anpassungen der Bewirtschaftung. Dies führt zu Konflikten; Erste Tourismusverbände reagieren mit Informationskampagnen oder Projekten wie „Sennalmen“.
Zahlen zur Land- und Almwirtschaft in Tirol
- 54 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind Almfutterflächen, die sich auf 2.099 Almen verteilen.
- Tirol weist einen besonders hohen Anteil an gealpten Milchkühen auf: 49 % der Milchkühe verbringen den Sommer auf der Alm (Vorarlberg 34 %, Salzburg 14 % und Südtirol 3,5 % ).
- Knapp drei Viertel der Betriebe bewirtschaften weniger als 15 Hektar Fläche. Milchviehbetriebe halten im Durchschnitt zwölf Milchkühe.
- Die Fläche des Dauergrünlandes sank seit 2010 insgesamt um 23 %, wobei die intensiv genutzte Fläche um 2% zunahm.