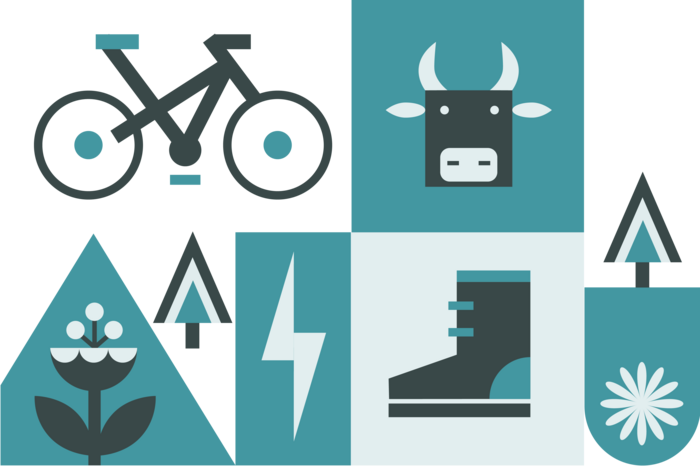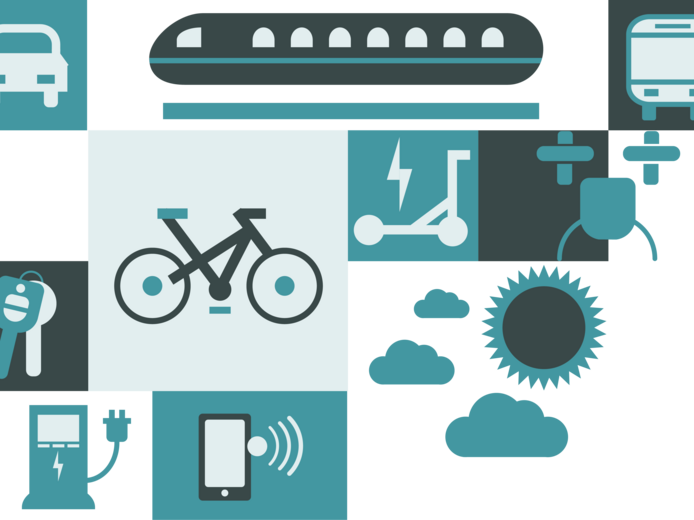Konflikte treten nicht nur auf, wenn Einzelne oder Gruppen unterschiedliche Ziele verfolgen, sondern auch, wenn sie zwar die gleichen Ziele haben, sich aber durch unterschiedliche Wege, diese Ziele zu erreichen, in die Quere kommen (Jacob & Schreyer, 1980). Der begrenzte Raum, verbunden mit der Zunahme von Freizeitaktivitäten in der freien Natur, birgt einerseits das Risiko von Konflikten zwischen Menschen, die an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen (Happ & Schnitzer, 2022). Andererseits kommt es aufgrund der Vielzahl an Aktivitäten in der alpinen Natur zu einer starken Beanspruchung dieser Räume und damit zum sogenannten Mensch-Natur-Konflikt (Happ et al., 2022).
Vor allem für Tourismusverbände, Gemeinden und Politik kann es von großer Bedeutung sein, die zugrundeliegenden Mechanismen dieser Konflikte zu verstehen (Pröbstl-Haider et al., 2018; Happ & Schnitzer, 2022). Aus diesem Grund ist Besucherlenkung im alpinen Raum immer wichtiger. Dies umfasst räumliche, zeitliche und zahlenmäßige Vorgaben, die dazu dienen, die Natur zu schützen und die touristische Akzeptanz der Gesellschaft aber auch die der Gäste zu erhalten (Manning et al., 2017; Selvaag et al., 2020).
Besuchermanagement umfasst alle Maßnahmen, die zur Lenkung von Besucherströmen und damit zur Attraktivitätssteigerung, aber auch zum Schutz einer Destination beitragen können und dienen auch dazu, dass Freizeitsportler achtsam handeln und dennoch ihre Aktivität genießen können (Manning et al., 2017; Selvaag et al., 2020).
Maßnahmen zur Besucherlenkung im alpinen Raum
- Nutzungsbeschränkungen regulieren die Aufenthaltsdauer, um Überbelastung der Umwelt- und Infrastrukturressourcen zu vermeiden, es soll jedoch mit Bewusstseinsbildung/Information und nicht mit Verboten gearbeitet werden
- Änderung von Nutzungsmustern tragen mit der Verlagerung oder Änderung der Besucherströme zum Ziel einer gleichmäßigeren Nutzung bei
- Erhöhung des Angebots durch eine räumliche oder zeitliche Ausweitung des Angebotes - beispiels-weise durch Saisonverlängerung, längere Öffnungszeiten oder Ausbau der Infrastruktur